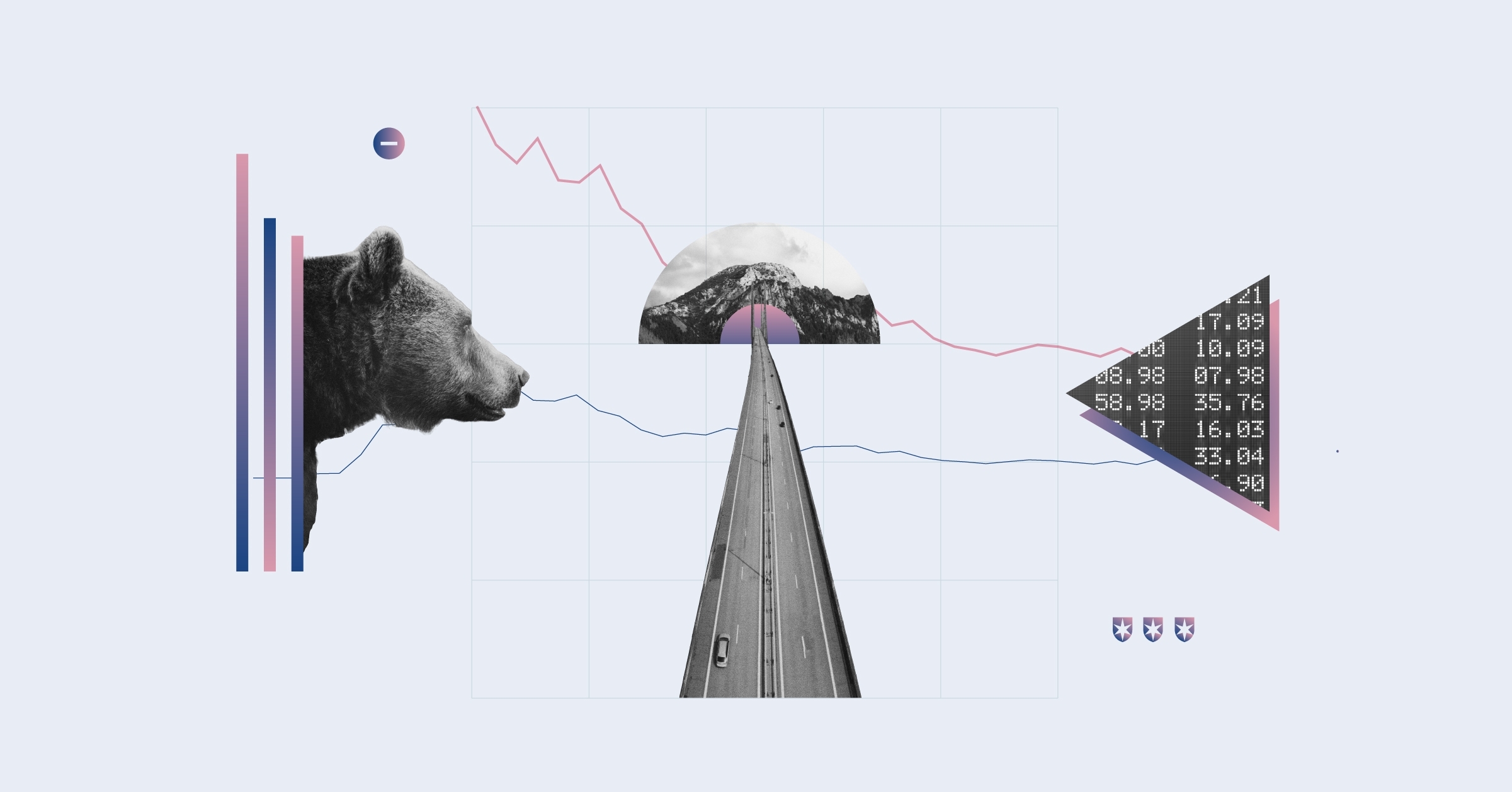Die Verhaltensökonomie (Behavioural Finance) beschäftigt sich mit menschlichem Verhalten in wirtschaftlichen Situationen. Ein bisher wenig bekanntes Teilgebiet davon, die Neuroökonomie, analysiert der amerikanische Wirtschaftsjournalist Jason Zweig in seinem Buch ‚Your Money and Your Brain‘. Darin geht es darum, wie das Gehirn in Finanzangelegenheiten reagiert. Wir unterhielten uns vor kurzem mit Zweig über das typischen Anlegerverhalten und was man tun kann, um zu einem besseren Anleger zu werden.
Vielen Anlegern ist die Verhaltensökomomie ein Begriff. Wie unterscheidet sich davon die Neuroökonomie?
Die Neuroökonomie nutzt die Instrumente der Neurowissenschaft, um zu zeige
n, welche Bereiche des Gehirns unter bestimmten Bedingungen aktiviert werden. Dann sucht man nach einem Zusammenhang zwischen dieser Aktivität und einer bestimmten Verhaltensweise oder dem Auslöser für diese Aktivität.
Wenn wir z.B. etwas über die Prozesse im Gehirn erfahren möchten, die unser Risikoverhalten bestimmen, können wir jemanden damit konfrontieren, einen kleinen Geldbetrag zu gewinnen oder zu verlieren. Wir können dann beobachten, was bei dieser Person im Gehirn auf Ebene der Neuronen passiert. Schon vor 30 Jahren fanden Kahneman und Tversky heraus, dass Menschen die Intensität eines Verlustes etwa doppelt so stark fühlen wie die Freude über einen gleich großen Gewinn. Daher schmerzt es etwa 2 bis 2,5 Mal mehr, 100 Euro zu verlieren, als es Freude bereitet, dieselben 100 Euro zu gewinnen. Generell bestätigen neuroökonomische Experimente dies, da sie zeigen, dass bei einem Geldverlust Regionen des Gehirns aktiviert werden, die mit physischem Schmerz und Ekel in Verbindung gebracht werden, wie z.B. wenn man Erbrochenes riecht oder in einen Hundehaufen steigt.
Sie haben sich selbst einigen dieser Experimente unterzogen. Was haben Sie dabei über sich selbst herausgefunden?
Zunächst einmal habe ich erfahren, dass ich bei diesen Experimenten nicht besser abschneide als andere und teilweise sogar schlechter. Das einzig Ungewöhnliche war, dass ich in mindestens einem der Tests eine erstaunlich hohe Geduld aufwies. Ich bin bereit, merklich länger auf eine Belohnung zu warten als eine Durchschnittsperson.
Das ist beim Investieren vorteilhaft.
Das stimmt. Interessanterweise war es aber nicht genau das, was mein Gehirn-CT zeigte. Es war vielmehr das Ergebnis eines Verhaltensexperiments. Anscheinend habe ich durch langjähriges Training und Disziplin, durch die Lektüre des Value-Investors Benjamin Graham, durch die Beobachtung der Märkte und durch historische Analysen mehr Geduld erworben, als es meiner genetischen und biologischen Veranlagung entspricht.
Am stärksten war ich über ein Experiment überrascht, das der Neurowissenschaftler Gregory Berns als ‚unbewusstes Lernen‘ bezeichnet. Tatsächlich kann das Gehirn Muster erkennen, ohne dass uns jemals bewusst würde, dass wir diesen ausgesetzt waren. Wie wenn Menschen bei Tradingaktivitäten etwas zwei oder dreimal hintereinander geschehen sehen und daraus schließen, dass es sich wiederholen wird – Ähnliches spielt sich ständig in unserem Gehirn ab, ob wir es wollen oder nicht. Und es kann unser Verhalten bestimmen, auch wenn wir versuchen, uns zu widersetzen, es sei denn wir haben formale Entscheidungsstrukturen installiert, die uns davon abhalten.
In diesem speziellen Experiment sollte ich die Wahrscheinlichkeit für etwas einschätzen. Dies erforderte viel bewusstes Nachdenken wie beim Schach. Gleichzeitig wurde mein Gehirn mit kleinen Mengen Zuckerwasser stimuliert. Das erfolgte nach einem bestimmten Muster, dem ich bewusst keine Aufmerksamkeit schenkte, da ich damit beschäftigt war, eine Lösung für das komplexe Problem zu finden. Der unbewusste Teil meines Gehirns merkte aber bald, was es mit dem Zuckerwasser auf sich hatte. Daraufhin fing ich an, mit meinem rechten Zeigefinger wild drauf los zu drücken um zu zeigen, dass ich das Problem gelöst hatte, obwohl ich nicht wusste, wie ich es getan hatte. Es lag einfach daran, dass das Muster für das Zuckerwasser anfing sich zu wiederholen und ein Teil meines Gehirns dies erkannte, während der bewusste Teil immer noch nach der Lösung des Problems suchte.
So etwas passiert an den Finanzmärkten ständig. Privatanleger verhalten sich so, aber auch Finanzberater, ohne es zu realisieren. Es führt dazu, dass man mehr Aktien eines bestimmten Unternehmens kauft, weil man dessen Vorstandsvorsitzenden im Fernsehen sah und er eine Krawatte in der eigenen Lieblingsfarbe trug. Es klingt absurd, seine Entscheidungen an solch irrelevanten Faktoren auszurichten, aber es passiert. Dies liegt daran, dass Dinge wie Farben, Töne, Gerüche, Geschmacksrichtungen oder andere Assoziationen mit der Vergangenheit oder sich selbst unser Wohlbefinden und unsere Vertrautheit mit einer furchterregenden Welt steigern.
All dies bestimmt unser Entscheidungsverhalten, ohne dass wir es merken würden. Es ist eines der aufregendsten Forschungsgebiete in der modernen Psychologie, wie unsere unbewussten Neigungen und deren Einfluss auf unser Verhalten unsere Entscheidungen in einer Art beeinflussen, die uns unvorstellbar ist. Niemand würde glauben, dass er/sie seinen Mann oder seine Frau geheiratet hat, weil deren Nachname mit demselben Anfangsbuchstaben anfängt wie der eigene. Betrachtet man allerdings Millionen von Ehen, stellt man genau das fest.
Natürlich spielt auch Liebe eine Rolle, aber es kann sehr wohl am Anfangsbuchstaben gelegen haben, dass man sich besonders zu ihm oder ihr hingezogen fühlte, was wiederum ein Hauptgrund für die Heirat gewesen sein mag. Ein Blick in Anlegerdepots zeigt, dass darin heimische Unternehmen oder solche, deren Namen an den eigenen oder den Namen in der Familie erinnert, darin übergewichtet sind.
Was können wir als Anleger dagegen tun?
In den letzten Jahren wurde viel Aufheben um Intuition, Bauchgefühl und Vorahnungen gemacht. Man kann sich aber keine schlechtere Entscheidungsgrundlage vorstellen, zumindest in Finanzangelegenheiten. Das heißt nicht, dass man niemals auf sein Bauchgefühl hören sollte oder dass die eigene Intuition immer unzuverlässig ist. Sie ist allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen ein guter Ratgeber, und sie hängt stark von der Art des Feedbacks ab. Nehmen wir als Beispiel einen professionellen Tennisspieler. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Ein Fehler führt dazu, dass man im Spiel zurückfällt, ein sehr hohes Preisgeld steht auf dem Spiel und das Feedback erfolgt außerdem sofort. Überlegen Sie nun, welches Feedback Sie an den Finanzmärkten bekommen: Sie kaufen die ABC-AG und zahlen 10 Euro je Aktie. Wenn sie Ende des Tages bei 10,05 Euro steht, gratulieren Sie sich selbst und sagen: ‚Ich bin ein guter Anleger‘. Am nächsten Tag sinkt der Kurs auf 9,50 und plötzlich sind Sie ein schlechter Anleger. Sie verkaufen und sehen dann, dass die Aktie nun auf 12 Euro steigt. Was denken Sie dann? Nun, Sie können sich für einen guten Anleger halten, weil sie 20% über ihrem ursprünglichen Kaufpreis notiert. Sie können aber auch schlussfolgern, dass Sie nicht wissen, was sie tun, da Sie sie zum genau falschen Zeitpunkt verkauft haben. D.h. die Art des Feedbacks variiert ständig. Sie hängt vom Betrachtungszeitraum ab. Die Finanzmärkte liefern insgesamt sehr schlechtes Feedback. Da gibt es viel Lärm. Es erfolgt zeitverzögert und ist nicht eindeutig. Man kann sich auch das Beste heraussuchen, um besser auszusehen oder sich selbst zu belügen.
Daher sind gute Entscheidungsstrukturen so wichtig. Man sollte eine Checkliste führen, vergangene Entscheidungen analysieren und schauen, was die erfolgreichsten Investoren der Welt anders machen. Und aus deren sowie den eigenen Fehlern lernen. Es lohnt sich, eine Liste mit Kriterien aufstellen, die jedes Investment erfüllen sollte, bevor es für das eigene Depot in Frage kommt. Für Privatanleger lautet die wahrscheinlich wichtigste Regel: Kaufen Sie niemals nur deshalb, weil der Kurs eines Investments davor gestiegen ist und verkaufen sie nicht, nur weil der Kurs gefallen ist. Setzen Sie für Gebühren und die Umschlagshäufigkeit ein Maximum fest, das nicht überschritten werden darf. Achten Sie auf die steuerlichen Rahmenbedingungen und das Risiko. Die Performance wäre für mich das allerletzte Kriterium. Ich würde mir die Performance sogar erst anschauen, nachdem ich eine Vorauswahl mit Fonds getroffen habe, die alle anderen Kriterien erfüllt haben. Überprüft man die Rendite zuerst, wird sie zu einem unbewussten Entscheidungsfaktor, der alle weiteren Analysen verzerrt.
Im ‘Journal of Finance’ gab es vor einigen Jahren eine sehr aufschlussreiche Geschichte über die Auswahl institutioneller Vermögensverwalter. Dabei kam heraus, dass diejenigen, die für Pensionsfonds u.ä. Portfoliomanager auswählen, ebenfalls dazu neigen, teuer zu investieren und billig zu verkaufen. Sie investieren bei den Managern mit der besten Dreijahresperformance und verkaufen diejenigen mit der schlechtesten Dreijahresrendite. Hätten sie genau umgekehrt gehandelt oder sogar gar nichts getan, wären die Renditen besser ausgefallen. Die Performancejagd ist nicht nur bei Privatanlegern verbreitet. Jeder nimmt daran teil. Professionelle Anleger sind meiner Meinung nach mindestens genauso davon betroffen wie Privatanleger. Darauf deuten auch empirische Studien hin.
Der gesunde Menschenverstand würde einem sagen, dass man als Verwalter fremden Geldes genauso risikoavers ist wie mit dem eigenen. Es handelt sich aber um eine andere Art von Risiko. Man möchte das Risiko vermeiden, gegenüber der Person, die einen bezahlt, schlecht da zu stehen. Was einen wiederum schnell dazu verführen kann, teuer zu kaufen und billig zu verkaufen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung sehen Sie damit nämlich besser aus als umgekehrt. Das Problem dabei ist, dass dies langfristig nicht zu einer Maximierung des Anlagevermögens führt. Dieser Interessenkonflikt wird in der Prinzipal-Agent-Theorie beschrieben. Finanzberater müssen sich mit diesem Problem auseinandersetzen. Sie müssen nicht nur das gehaltene Portfolio beobachten, sondern auch das ‚verkaufte‘. Ich kenne nur ganz weniger Berater, die das tun. Manche sehen auch nicht ein warum. Es ist jedoch die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob man eine gute Entscheidung getroffen hat. Wenn es eine falsche Entscheidung war, ist es auch die einzige Möglichkeit, daraus zu lernen.
Wir haben dies auch auf Fondsebene untersucht. Wir haben die Einzelwerte quasi fixiert und untersucht, wie sich dieses Portfolio gegenüber dem tatsächlichen Portfolio entwickelt hätte. Tatsächlich wäre es besser gewesen, wenn ein Fondsmanager das Portfolio, das er vor einem oder drei Jahren hatte, unverändert weitergeführt hätte.
Dieses Ergebnis sollte niemanden überraschen. Zum einen müssen ja Transaktionskosten berücksichtigt werden. Teilweise verzögert sich auch die Implementierung und es dauert, bis man eine Aktie durch die andere ersetzt. Doch der wichtigste Grund ist meiner Auffassung nach ein psychologischer. In dem Moment, in dem eine Aktie das meiste Kopfzerbrechen bereitet, ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zukunftsträchtiges Investment. Was sich dagegen heute sehr gut anfühlt, ist wahrscheinlich langfristig genau das Falsche. Menschen werden also durch ihre Emotionen dazu getrieben, dasjenige zu kaufen, das sich gut anfühlt und das los zu werden, was schmerzt. Sie merken dabei nicht, dass sie damit die Grundlagen dafür legen, in Zukunft immer wieder das Gleiche zu tun.
Lesen Sie nächste Woche die Fortsetzung dieses Interviews.
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.